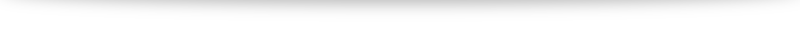Eine Fortsetzung von Faserland, jener 90er-Jahre-Novelle, mit der Christian Kracht berühmt wurde, soll es sein. Begab sich damals der Ich-Erzähler alleine auf eine Tour von Sylt nach Zürich, sucht er nun seine Mutter in selbiger Schweizer Stadt auf, um mit ihr zu verreisen und dabei möglichst viel Geld loszuwerden – was den Buchtitel Eurotrash zur Hälfte erklärt: Die beiden handhaben Banknoten wie Ramsch, nur dass es sich um Schweizer Franken und nicht um Euro handelt. Sei’s drum, schon der Name Faserland war inkorrekt, nämlich eine Verballhornung von „Fatherland“.
Die Unstimmigkeit des neuen Titels könnte man dem Umstand zurechnen, dass der Erzähler selbst nicht weiß, wo er hingehört („Nie habe ich verstanden, warum ich, als ich die Schweiz mit elf Jahren verlassen hatte, um ins kanadische Internat zu gehen, danach immer um die Welt ziehen mußte…“). Aus Krachts brüchiger wie reichhaltiger Biographie folgt ein Spagat: Das Buch beginnt mit einer Reflektion der in die deutsche Nazi-Vergangenheit verstrickten Familiengeschichte, um dann in Form einer Reiseschilderung der Alpenrepublik einen Spiegel vorzuhalten, kosmopolitische Apercus inbegriffen („So sind sie die Schweizer… fast ostasiatisch in ihrem Bemühen, Unangenehmes zu vermeiden.“)
In der Zur-Schau-Stellung Schweizer Zustände kann man eine Parallele zu Dürrenmatts Besuch einer alten Dame sehen, dem Drama über die Wohlstandsgesellschaft. Wie dort ist die von Krachts Ich-Erzähler besuchte Mutter eine reiche Seniorin, die über andere Menschen Macht gewinnt. Diese verdankt sie jedoch nicht allein ihrem Geld, sondern auch ihrem Geist, der sich in schlagfertigen Entgegnungen äußert, wodurch das Erzählte zu einem selbstironischen, stellenweise metafiktionalen Spiel wird.
Zu einem Ziel führt all das wiederum nicht. Die beiden kehren zum Ausgangspunkt ihrer Reise zurück, ohne gesehen zu haben, was sie sehen wollten: Edelweiß und Zebras. Geld und Geistesblitze haben nichts geklärt oder verbessert, höchstens eine Illusion hervorgerufen. Zu den anrührenden Momenten gehören jene, in denen die schwerkranke Mutter ihren Sohn bittet, ihr eine Geschichte zu erzählen, um sie von ihrer konkreten Bedrängnis abzulenken. Er tut dies und trägt sie kraft Fantasie hinfort. Es ist sein Rezept in einer verworrenden Welt. „Ich hatte immer gelebt in den Träumen, in den Gespenstern der Sprache“, dieses sicherlich unironisch gemeinte Bekenntnis erklärt, weshalb der Autor überhaupt etwas zu Papier bringt. Das Resultat sind keine Antworten auf Fragen, sondern mal melancholische, mal witzige Fluchten aus den traurigen Tatsachen.