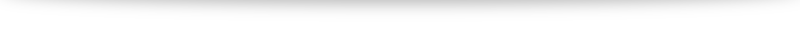Wie sehr ist das, was wir bewundern, bloß eine Illusion? Die Fallhöhe vom Schein zur Wirklichkeit kann groß sein: Ein Zauberer gibt auf der Theaterbühne eine telepathische Meisterleistung zum besten, dabei hat er sich lediglich mit einem Beteiligten vorher abgesprochen. So beginnt Martin Mosebachs jüngster Roman, dessen Hauptfigur, der Geschäftsmann Ralph Krass, ebenfalls etwas Magisches hat. Er zieht andere in seinen Bann, um sich ihrer wie Marionetten zu bedienen. Auch dieser Zauber ist faul.
Für den Rezensenten des Deutschlandfunks will Mosebach einen „zeitlosen dionysischen Charakter“ darstellen, weshalb der Roman auch Anfang des 20. Jahrhunderts oder in den späten Fünfzigern erschienen sein könnte. Er ist aber 2020 erschienen und spielt hauptsächlich in den Jahren 1988/89, bevor er zum Schluss einen Sprung um 20 Jahre macht. Während der Erzähler zeitgeschichtliche Ereignisse ausspart, betont er umso mehr die Statur und Anziehungskraft des massigen, hochgewachsenen Machtmenschen Krass. Man könnte sich äußerlich an Helmut Kohl erinnert fühlen, zumal die erzählte Zeit am Scheitelpunkt von dessen Kanzlerschaft angesiedelt ist. Auch methodisch gibt es eine Übereinstimmung: Krass verfügt über viel Geld und macht damit die Menschen um sich herum gefügig, was man in der Kohl-Ära Scheckbuchdiplomatie nannte („You have deep pockets“, soll Bush senior zum Bundeskanzler gesagt haben, als es um die Zustimmung der Sowjetunion zur Wiedervereinigung ging). Der körperliche und ökonomische Koloss als Sinnbild eines Landes, das durch Wirtschaftspotenz seine Umgebenden regiert.
Viel weiter lässt sie die Parallele zwischen Roman- und historischer Figur aber nicht ziehen. Oder doch? Krass wurde reich durch dubiose Waffengeschäfte mit Ägypten und geht Bankrott. Allerdings ficht ihn das nicht an und er hat das Glück, in Kairo an einen Mann zu geraten, der in ihm einen Vater sieht und ihn bis zum Tod pflegt.
Dieser Edelmut steht zum einen im Kontrast zur Verkommenheit, die im Kairo-Kapitel den Leser in Gestalt einer Kellnerin anspringt, die sich Krass andient, indem sie ihm per Handyvideo zeigt, wie ihr Ehemann (für den sie eine Frau von mehreren ist) sie zum wöchentlichen Sex besucht. Krass geht darauf ein. Die selbstlose Hilfe des Ägypters hebt sich zweitens von dem Umgang ab, der das europäische Netzwerk um Krass bestimmt: das bloß instrumentelle Interesse oder das Desinteresse am Mitmenschen. Das Buch endet damit, wie nach Krass‘ Bestattung zwei seiner früheren Gefolgsleute gleichgültig auseinandergehen. Inwiefern hiermit der deutschen oder westlichen Gesellschaft ein Spiegel vorgehalten wird, wäre die Frage.
Den Bucheinband schmückt ein Bachstelzenpaar, das sich an Schnabelspitzen und Beinen berührt. Die entsprechende Szene im Roman erweist jedoch, dass es nicht um zwei einander zugewandte Lebewesen geht, sondern nur um einen Vogel, der in einer Pfütze sein Spiegelbild anpickt. Noch beziehungsgestörter als dieser Narzist wirkt ein Wellensittich, der eines Tages seinem Weibchen den Kopf aufhackt und nach dem Mord aus dem Käfig guckt, als wäre nichts geschehen und als würde er niemanden vermissen. Ein krasses Bild von Gleichgültigkeit, ein Zerrbild von Krass und den Menschen um ihn herum.