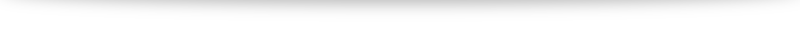Mit der Vergabe des Literatur-Nobelpreises an Peter Handke im Herbst kochte die Kritik an seiner Parteinahme für Serbien im Balkankrieg hoch. Seine danach erschienene Erzählung Das zweite Schwert soll zwar keine Reaktion darauf sein, denn sie wird auf den Mai 2019 datiert, trotzdem passt sie dazu:
Der Ich-Erzähler will den Selbstmord seiner Mutter rächen, den diese beging, weil ihr durch einen Zeitungsartikel, in welchem sie als frühere Befürworterin des Hitler-Regimes hingestellt worden war, eine Mitschuld am Holocaust aufgebürdet worden war. Zeitungsjournalisten schmäht der Erzähler als „Fernschreiber“, und man darf annehmen, dass dies Handkes Ansicht über all jene Multiplikatoren in der westlichen Öffentlichkeit entspricht, die den Zerfall Jugoslawiens aus der Ferne beurteilten, während er Serbien höchstselbst bereiste. Auch in dieser Auseinandersetzung wurden die Nazi-Verbrechen ins Spiel gebracht: Interventionsbefürworter sprachen von einen neuen Holocaust, den es zu verhindern gelte.
In der Erzählung wird die aus der historischen Schuld erwachsene Obsession auf die Spitze getrieben: „Vergleichbares (nein, nichts ist ‚vergleichbar‘) war mir lang vorher einmal, ein einziges Mal, begegnet: ein anonymer Brief mit der Drohung, mein Kind zu töten, schaffte ich es nicht, die sechs Millionen von meinen Vorfahren (das nur zwischen den Zeilen) getöteten Juden zum Leben zu erwecken.“
Der Erzähler setzt allerdings selbst die Folge aus Schuld und Vergeltung fort: Er beschließt, an der Autorin des Zeitungsartikels, der den Tod der Mutter verursacht hat, Rache zu nehmen und sucht ihr Haus in der Ile-de-France auf. Die Schilderung dessen, was er auf diesem Weg durch das Weichbild von Paris sieht und reflektiert, macht einen Gutteil des Buches aus.
Was die äußeren Eindrücke angeht, kann man sich punktuell an Houellebecq erinnert fühlen: Der Westen als eine Mischung aus Verwahrlosung und Hypermoderne; eine Spaßgesellschaft, die sich andeutet, wenn auf den ersten Seiten „die im Lauf der Jahre, nicht bloß in Frankreich, zahlreich gewordenen Ferien“ angemerkt oder gegen Ende eine für Bridge-Spiele umfunktionierte Kirche beschrieben werden. Bei Handke, der früher schon einen „müden Blick“ propagierte, steigern sich diese Dekadenz-Beobachtungen freilich nicht zur selben Eindringlichkeit wie in Houellebecqs Prosa. Handkes Erzähler sagt von sich selbst, ihm fehle „jeder wissenschaftliche Blick und Ehrgeiz“; seine Sache sei, „etwas, ohne ein Zutun, gewahr zu werden“ und in seiner eigenen „Einbildung“ damit „wegzudriften“. Zu dieser Kombination aus Zurückhaltung und Eigenmächtigkeit passt der Sprachstil: Nicht wenige Passagen zieht der Erzähler in die Länge, indem er sich mit Einschüben vortastet, seine Worte durch Wiederholungen bestärkt, durch Variationen und Neuschöpfungen erweitert oder auch (wie im obigen Zitat vom Drohbrief) verwirft.
Diese Struktur erfordert beim Lesen Geduld, zumal sie auch die Plotebene prägt: Der Rachwillige macht Umwege, zögert die Bluttat hinaus, um sie letztlich durch etwas anderes zu ersetzen. Vordergündig mag sich das damit erklären, dass er in einer Kneipe und in weiblicher Gesellschaft landet. Liebe überwindet Hass, sozusagen. Zuvor begegnet aber ein stärkeres Motiv: Im Abendbus erblickt der Protagonist eine „dunkelschwarze Gestalt“, die ihn spontan an einen Attentäter denken lässt, bevor er Augen bekommt „für den auf das emporgezogene Knie gestützten Arm der Afrikanerin und die Hand mit dem Buch; nein, was sich so sehen ließ, war das Gegenteil von einem Gespenst oder Schreckensbild. Und das kam von dem Weiß der Buchseiten, wie es aufleuchtete beim Umblättern“. Drei Farben fügen sich zu einem „Friedensbild“; es sind Farben einer „Friedensflagge“: „Hier nun, am Grün hinterm Busfenster, am Weiß der Buchseiten und am Schwarz-in-Schwarz dieser Leserin, kamen solche Fahnenfarben erstmals nicht aus der Natur allein. Und ich stellte mir vor, wie im tiefen Afrika dereinst das Lesen weitergehen würde.“
Afrika als Ort des Friedens und der literarischen Zukunft – diese Vision stellt zumindest einen Gegenentwurf zur gewaltsamen und stets rückwärtsgerichteten Abrechnung von Schuld dar. Ein Wunschbild vielleicht auch dafür, Europas Erblasten ablegen zu können.
In der Bibel ist die Erbsünde mit der Schlange verbunden. Auch Handke greift dieses Symbol auf, nur kehrt er es um: Nicht die Schlange verführt zur Sünde, sondern sie ist das Opfer schuldhaften Tuns. So in der Lebensgeschichte des Wirts, den der Erzähler zu besuchen pflegt. Dieser hatte in seiner Soldatenzeit eine Urwaldschlange geschenkt bekommen und sie im Schlaf erdrosselt. „Meine ewige Schuld!“, bekennt er. Auf ihrem „Rachefeldzug“ erinnert sich die Hauptfigur an eine „tiefschwarze“ Schlange in einer „Grabenwildnis“, die für den Bau einer Bahnstrecke beseitigt wurde, weshalb auch die Schlange verwunden ist – bis sie hinter der entweihten Kirche noch einmal auftaucht.
Die Umdeutung der Schlange, deren Afrika-Bezug hier auf der Hand liegt, ließe sich als eine Abkehr von der biblischen, also abendländischen Schuld-Tradition verstehen. Doch worin besteht diese Wendung konkret? Im Zug beobachtet der Erzähler die Gesichtsbewegungen eines Afrikaners: „Ober- und Unterlippe einander sich nähernd, aber ohne Berührung, und wenn einmal, dann so zart, und zarter nicht möglich; wie seit jeher fraglos und seit jeher auch keine Antwort erwartend, ohne ein Bewusstsein überhaupt von Wort wie Sachverhalt ‚Antwort‘ und ‚Antworten‘: er betete.“ Im Gegensatz zu dieser milden, bittenden, keine Rechenschaft verlangenden Haltung steht die Journalistin, „eine der Myriaden öffentlich agierender Frauen“, wie sie am Schluss in einer Talkrunde auf dem Bildschirm der Kneipe erscheint. Drei Paar Brillen hat sie auf: „eine oben auf dem Kopf, eine vor den uneinsehbaren Augen und eine an einer Schnur vor der Brust, und sie schrieb immer wieder etwas auf, mit einem überlangen Bleistift“. Ein abwertendes Sinnbild für den Anspruch, alles zu sehen und zu erfassen.
Man kann über diese Zuschreibung und Kontrastierung geteilter Meinung sein wie über Handkes politische Positionierungen überhaupt, überraschend und risikofreudig ist seine Afrika-Projektion jedenfalls – sie könnte im politisch korrekten Klima als kolonialistisches (oder gar rassistisches) Klischee angegriffen werden. Der Schluss dieser Geschichte legt allerdings nahe, diesem Impuls nicht zu folgen, sondern gelassen zu bleiben.
Ohnehin ist das Afrika-Motiv zwar bedeutsam, aber keineswegs vorherrschend; es tritt nur an wenigen Stellen in diesem an Bildern, akustischen Impressionen, mythologischen Anspielungen reichen Bändchens hervor. Wer als Leser an solchen poetischen Qualitäten Gefallen hat, wird verzeihen, dass das Eingangs-Versprechen einer spannenden Rache-Handlung nicht eingelöst wird.