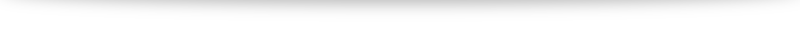Da staunt man ein zweites Mal. Die sagenhafte Inkastadt Machu Picchu auf einem Bergsattel im peruanischen Urwald wurde nicht erst 1911 von dem amerikanischen Historiker Hiram Bingham entdeckt, sondern vierzig Jahre früher vor einem Mann, der um 1840 als Sohn eines Weinhändlers in Uerdingen am Niederrhein geboren und aufgewachsen war, einige Jahre in Berlin ein Hugenottengymnasium besuchte, nach dem Unfalltod seines Vaters als Schlosser in einer Fabrik bei Solingen arbeitete, bevor er sich heimlich nach Peru einschifft, weil er von den Inka begeistert ist und die Vision hat, El Dorado finden zu können.
Rudolph August Berns geriet jedoch in Vergessenheit – bis seine Rolle durch einen Fund eines amerikanischen Forschers in der Nationalbibliothek von Peru im Jahr 2008 wieder bekannt wurde. Die in Münster lebende Autorin Sabrina Janesch erfuhr in einem Zeitungsartikel von dem deutschen Entdecker Machu Picchus und war davon so fasziniert, dass sie sich auf die Suche nach allen Zeugnissen seines Lebens in Archiven in Deutschland, Panama und Perumachte und in Gesprächen mit Nachfahren seiner Familie Erinnerungen zusammentrug. Entstanden ist daraus der Roman Die goldene Stadt, der seit September im Handel ist.
Das Buch liest sich wie eine Abenteuergeschichte. Janesch erzählt mit Schwung und reicher Darstellung historischer Alltagsdinge die Stationen und Wechselfälle eines Lebens, das vom Goldwaschen am Ufer des Rheins über eine Begegnung mit dem greisen Alexander von Humboldt in Berlin, den spanischen Angriff auf Callao am 2. Mai 1866, den Eisenbahnbau nach Cuzco, Eskapaden in New York bis zur Baustelle des Panamakanals reicht und im Lima der 1880er Jahre und am Urubamba-Strom seine Höhepunkte hat.
In Berns‘ Blick auf die Welt mischt sich immer wieder seine Fantasie. Er hat eine Stadt voller Gold vor Augen, doch das Machu Picchu, das er schließlich findet, ist leer. Seine größte Entdeckung ist deshalb seine größte Enttäuschung. Er versucht, trotzdem Kapital daraus zu schlagen, indem er Aktien der angeblichen Goldstätte verkauft und mit dem Erlös verschwindet.
Es ist das Leben eines Menschen, den man sich nach dieser Lektüre als wissbegierig und doch auch verträumt, idealistisch und zugleich goldgierig, gutmütig und dennoch unehrlich vorstellen muss. Diese Widersprüche gehen aus der äußeren Handlung hervor, ohne dass sie sich psychologisch voll erschließen. Das Innenleben der Figur Berns bleibt ein Rätsel; gewissermaßen steht der Leser vor dieser Lebensgeschichte, wie Berns vor den leeren Ruinen. Janesch, die diese Biographie freigelegt hat, erklärt bei einer Lesung ihres Romans, dass sie den Charakter durch freie Erfindungen ausgefüllt hat; manches, wie das „kaleidoskopische Denken“ des Protagonisten entspreche ihre eigenen Neigungen.
An Charakterwidersprüchen könnte es liegen, dass die reale Person Berns ihre große Pionierleistung nicht in Ruhm und Ehre, sondern nur in sehr zweifelhaften finanziellen Erfolg umgemünzt hat. Die Früchte erntet stattdessen Bingham, der im letzten Kapitel des Buchs als ein saturierter, spannungsloser Karrierist auftritt. Für Janesch kommt hierbei noch ein anderer Gegensatz ins Spiel: Berns sei noch ein Typ des (imperialistischen) 19. Jahrhunderts gewesen, für den es selbstverständlich war, Reichtümer fremder Kulturen an sich zu reißen und nach Europa zu führen. Bingham habe bereits einem anderen Geist des 20. Jahrhunderts angehört.