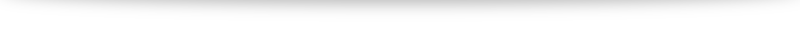Wenn beim Küssen einer nicht ganz dabei ist, das merkt man, weil Küssen ist Millimeterarbeit. Mit solchen nur vom Ton her lockeren, in Wirklichkeit aber passgenauen Beobachtungen erweist sich Marcus Fischers Kurzgeschichte „Wild campen“ selbst als eine Millimeterarbeit, ein Miniaturstück jedenfalls, in dem sich weit Größeres widerspiegelt. Da sind die jungen Berufstätigen Christoph und Anna, die zum Kitten ihrer Beziehung übers Wochenende wegfahren: sie am Steuer, er auf dem Beifahrersitz. Zur Harmonie kommen die beiden aber kaum, denn kleine Unaufmerksamkeiten reichen ihnen schon, um sich voneinander abzuwenden. Selbst das Küssen gerät so zur Zitterpartie.
Um dieses angespannte Paar herum zeigt sich eine Welt mit erquicklicher Natur, aber unerquicklichen Menschen: Auf dem Campingplatz, wo sie, nachdem sie andernorts mehrfach abgewiesen wurden, bleiben dürfen, entbietet ihnen ein Zeltnachbar ein steinernes „Grüß Gott“. Christoph macht in der Nacht eine Beobachtung, die den Verdacht hochschießen lässt, der Mann misshandle seine 13-jährige Tochter.
Damit kommt eine ganz andere Spannung in die Geschichte. Sie spielt übrigens in Österreich, dem Land von Natascha Kampusch und der Kellerfamilie des Josef Fritzl. Der Horrorhintergrund funkt dem jungen Paar ebenfalls ins „Beziehungswochenende“: Zeitweilig argwöhnt Anna, dass Christophs Verdacht nur ein Indiz für eigene pädophile Neigungen wäre.
So entwickelt Marcus Fischer eine zweigleisige Geschichte: von der Versteinerung der Alten und den Verspannungen der nachwachsenden Generation. Beim Literaturwettbewerb „Wortlaut“ des österreichischen Senders ORF wurde er zum Sieger gekürt (hier entlang).